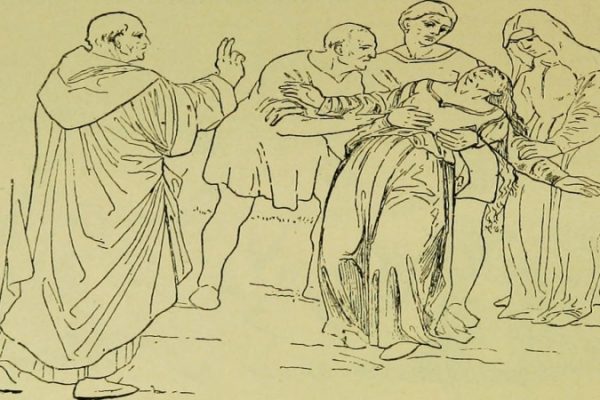Ein Gastartikel von Debbie Schmitt
Als ich Abd das erste Mal sehe, bin ich mit meiner Mutter in Koblenz unterwegs. Wir treffen ihn in einem Café, damit meine Mutter mit ihm den Mietvertrag besprechen kann. Während die beiden beginnen, gehe ich zur Theke. „Magst du auch was?“, frage ich ihn noch. „Nein, danke“, antwortet er und setzt das Gespräch mit meiner Mutter fort.
Wir beide sind fast gleich alt. Ich bin 19 und er ist 20. Was uns unterscheidet, ist also nicht das Alter. Vielleicht ist das sogar das einzige, was uns erstmal verbindet.
In der fünften Klasse schrieben meine Freund*innen und ich in unsere Freundschaftsbücher, dass wir den Krieg hassten und dass wir uns Weltfrieden wünschen. Dabei hatten wir noch keine Ahnung, wie Krieg wirklich ist. Dass der Krieg noch viel schlimmer ist, als alles was wir uns in unserer Phantasie je vorstellen könnten. Dass Krieg schlimmer als jeder Albtraum ist, den wir in unserer Kindheit hatten. Dass Krieg nicht nur ist, wenn Menschen sich gegenseitig hassen. Dass Zickenkrieg gar kein Krieg ist.
Alles was wir wussten, war, dass Krieg schlecht und Frieden gut ist. So unkompliziert war das früher für uns.
Von der fünften Klasse ging es dann irgendwann weiter in die Mittel- und letztlich in die Oberstufe. Hier wurden wir unter anderem über den Bürgerkrieg in Syrien, der seit 2011 andauert, im Sozialkunde-Leistungskurs unterrichtet, wobei unsere Lehrerin das Thema dankbar an den Überflieger unseres Kurses als Referatsthema abgab, weil offenbar selbst ihr die Komplexität zu groß war, um sie für uns nachvollziehbar zu machen.
Das Thema zu erklären, dafür hätte selbst unser Überflieger mehr Zeit gebraucht als sie ihm gab. Während wir die Theorie ansatzweise lernten und in den Büchern Bruchteile von dem lasen, was in Syrien vor sich geht, machte Abd sein Abitur genau dort. In Syrien, in der Schule, im Krieg.
Jetzt lebt er seit zwei Jahren in Deutschland. Seitdem lernt er die Sprache, trifft täglich auf die deutsche Kultur und auf die Menschen und lernt neue Freund*innen kennen. Er bespricht das ganze Bürokratische über das Mietverhältnis mit meiner Mutter auf Deutsch und weiß über Dinge Bescheid, von denen ich nicht weiß, was sie eigentlich bedeuten.
Ich denke an den Französischunterricht in der Schulzeit zurück. Ich war die Art Schülerin, die sich, falls sie sich doch einmal nach einer komplizierten Frage meldete, nur fragte, ob sie mal eben die Toilette aufsuchen dürfte. Das passierte auch in der Oberstufe noch, dabei hatte ich Französisch seit der fünften Klasse, nicht erst seit zwei Jahren.
In Syrien hat er 2015 auch sein Abitur gemacht, erzählt er mir. Ich hatte meines seit ein paar Monaten im März 2017 abgeschlossen und wollte mir erst noch durch das Sammeln von verschiedenen Erfahrungen darüber klarwerden, was ich danach mache.
Aber was, wenn man gar keine Wahl hat? Oder wenn die Wahl, die man treffen kann, nicht über sein späteres Einkommen oder den Wohlfühl-Faktor entscheidet, sondern darüber, ob man überlebt oder nicht?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Krieg ist. Das nicht zu wissen, was Krieg bedeutet, das ist der eigentliche Unterschied zwischen uns.
Während meine Mutter mit ihm die Mietregelungen bespricht, ist seine Mutter in Syrien. Seine Eltern wohnen in einer Wohnung in den Bergen, wo es „nur“ Geräusche von Waffen und Mörserbeschüssen gibt. Als er noch bei ihnen war, hatte seine Familie viel Angst um ihn. Er erzählt mir, dass sich die Menschen dort kaum auf ihre Arbeit, die Schule, Ausbildung oder ihr Studium konzentrieren können, weil sie Angst vor Mörsern haben. Ein Freund von ihm starb in der Schule als er versehentlich eine Mörsergranate traf.
Ein Gedanke bleibt mir dabei im Kopf: Den Erfahrungshorizont, den wir als Kinder erlebten, konnte sich keiner von uns aussuchen. Er nicht, ich nicht und auch sein Freund nicht. Und auch wer welches Leben bekam, lag nicht in unseren Händen.
Wenn Abd heute daran denkt, kann er nachts nicht gut schlafen. Er hat alles verloren. In Syrien hatte er ein kleines Auto und eine eigene Wohnung, bevor der Krieg alles zerstörte.
Vor allem aber musste er ab dem Zeitpunkt als er Syrien verließ, lernen, ohne seine eigene Familie zurecht zu kommen – auf einem Weg, den niemand zu bestreiten haben sollte. Er nahm einen Flug von Syrien in den Libanon und wartete dort zwei Stunden. Dann ging es direkt vom Libanon in die Türkei. Dort wartete er 20 Tage, weil der Meeresspiegel zu hoch war, um mit dem Boot weiterzufahren. Damals hatten ein paar Menschen trotzdem versucht, mit dem Boot nach Griechenland zu kommen. Von ihnen hat keiner überlebt, alle von ihnen sind ertrunken. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration sind im Jahre 2015 allein auf der Strecke zwischen Türkei und Griechenland mehr als 500 Menschen ertrunken. (http://www.zeit.de/politik/2015-12/mittelmeer-tote-fluechtlinge-boot)
Nach zwei oder drei Versuchen kam Abd in Griechenland an. Danach ging es mit unterschiedlichen öffentlichen Verkehrsmitteln weiter. Von Mazedonien ging es nach Serbien, dann nach Kroatien und über Österreich endlich nach Deutschland. Er sagt mir: „Je geduldiger man ist, desto besser wird die Reise.“
In Deutschland war er lange alleine bis er nach und nach Freund*innen und sogar eine Familie fand, die ihn unterstützten.
Es begann, als bei ihm, er wohnte in Hermersberg, die Heizung ausfiel und er die Nachbarsfamilie bat, ihm zu helfen. Sie gaben ihm eine kleine Heizung. Seitdem sind sie befreundet. Dadurch lernte er die deutsche Sprache, obwohl sie so schwer und kompliziert ist, sehr schnell. Sie halfen ihm in allen Bereichen, zum Beispiel auch dabei, einen Sprachkurs zu finden.
Über diese Menschen sagt er, dass er für immer in ihrer Schuld stehe, denn sie seien seine zweite Familie.
„Manchmal braucht man nur die Umarmung und einen Menschen, der dir sagt ‚Wir schaffen das zusammen.’ So haben die das gemacht.“
Wenn ich so etwas höre, würde ich am liebsten all den Menschen, die die Nächstenliebe mehr als den Hass füttern, in einer Gruppenumarmung vereinen und flüstern: „Es gibt sie, die Hoffnung.“
Dann zog Abd weg, weil es auf dem Land sehr schwer war, sich ein gutes Leben aufzubauen. Der Bus fährt dort nur einmal täglich und ohne Auto kommt man nur schwer oder gar nicht an sein Ziel.
Das kenne ich selbst zu gut aus meiner Jugend in der Provinz. Er zog nach Koblenz, wo er mehr Möglichkeiten hat, vor allem die Infrastruktur und das Studium betreffend. Dort besucht er eine andere Sprachschule und plant, sein Studium zu beginnen. Genau wie ich, zwar nicht in Koblenz, aber auch in einer größeren Stadt.
Wie auch ich hat er drei Geschwister. Seine zwei jüngeren Schwestern und auch sein jüngerer Bruder sind genau wie seine Eltern noch in Syrien. Seine Geschwister wollen das Land auch verlassen, aber momentan sei es sehr schwer, nach Europa zu fliehen. Er mache sich immer Sorgen um seine Familie. Wenn ihr etwas passiert, könne er seinem Leben nicht folgen, denn sie sei das wichtigste in seinem Leben und er hoffe sehr, dass es seiner Familie gut geht und das auch so bleibt.
Sein größter Wunsch ist es, seine Familie und seine Heimat wieder zu sehen und zu besuchen.
Auf seiner Flucht hat er natürlich viele Erfahrungen gesammelt, er ist guten und schlechten Menschen begegnet und hat mit der Zeit immer mehr gelernt, diese auseinander zu halten. Viele haben ein falsches Verständnis über die Syrer, sagt er. Manche denken, Syrer seien unterentwickelt oder es gäbe so etwas wie eine Entwicklung gar nicht, das Land sei nicht zivilisiert, die Menschen wüssten nichts über Wissenschaft, wollten nicht lernen und seien dumm. Einmal wurde er von einem Deutschen sogar gefragt, ob er wüsste, was ein Laptop oder ein Computer ist und ob er den an- und ausmachen könne.
Auch ich habe in den letzten Jahren gelernt, gute von schlechten Freund*innen zu unterscheiden und auf die Menschen zu achten, mit denen ich mich umgebe. Auf meinen Reisen sind mir viele sehr unterschiedliche Menschen begegnet und auch Rassismus habe ich schon mehrfach live mitbekommen. Ich habe also eine leise Vorstellung von dem, was Abd erlebt haben könnte, auch wenn unsere Vergangenheit kaum zu vergleichen ist.
Wir wissen beide, dass Rassismus da ist, auch wenn er ihn nicht beschreibt.
Was mir das Herz bricht, ist, dass ich weiß, dass es viele Menschen da draußen gibt, die genau wissen, was Krieg mit Menschen macht. Wie Krieg Menschen verstümmelt, umbringt, Familien zerreißt, Kinder und Frauen voller Angst zurücklässt. Wie Krieg Leid hervorruft, das wir nicht mehr therapieren oder heilen können. Wie Krieg etwas schafft, wofür selbst den besten Fachärzten das Vokabular fehlt, weil es keine Wörter dafür gibt. In keiner Sprache der Welt. Wie Krieg zerstört und es nichts auf der Welt gibt, das die Zerstörung rückgängig machen könnte.
Wenn diese Menschen, die das wissen, gegen die sind, die davor fliehen, dann bricht mein Herz.
Obwohl es natürlich auch viele Unterschiede zwischen den Kulturen gibt, findet Abd auch viele Gemeinsamkeiten. Er kommt aus Damaskus und findet die deutsche Kultur in einigen Aspekten ähnlich. Allerdings trinken Deutsche viel lieber Bier als Syrer, meint er.
Und ich habe mir niemals mehr gewünscht, dieser Weltschmerz ließe sich durch Bier heilen. Aber Weltschmerz ist unheilbar und Krieg ist das schrecklichste, was Menschen erleben können. Das weiß ich, obwohl ich nichts über den Krieg weiß.